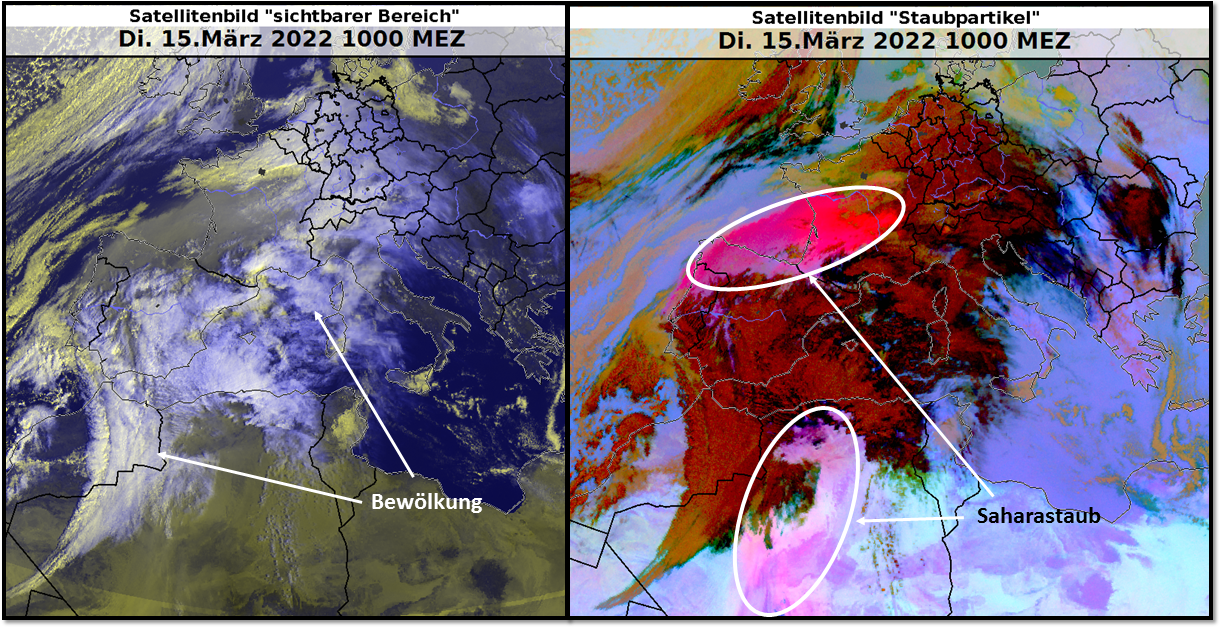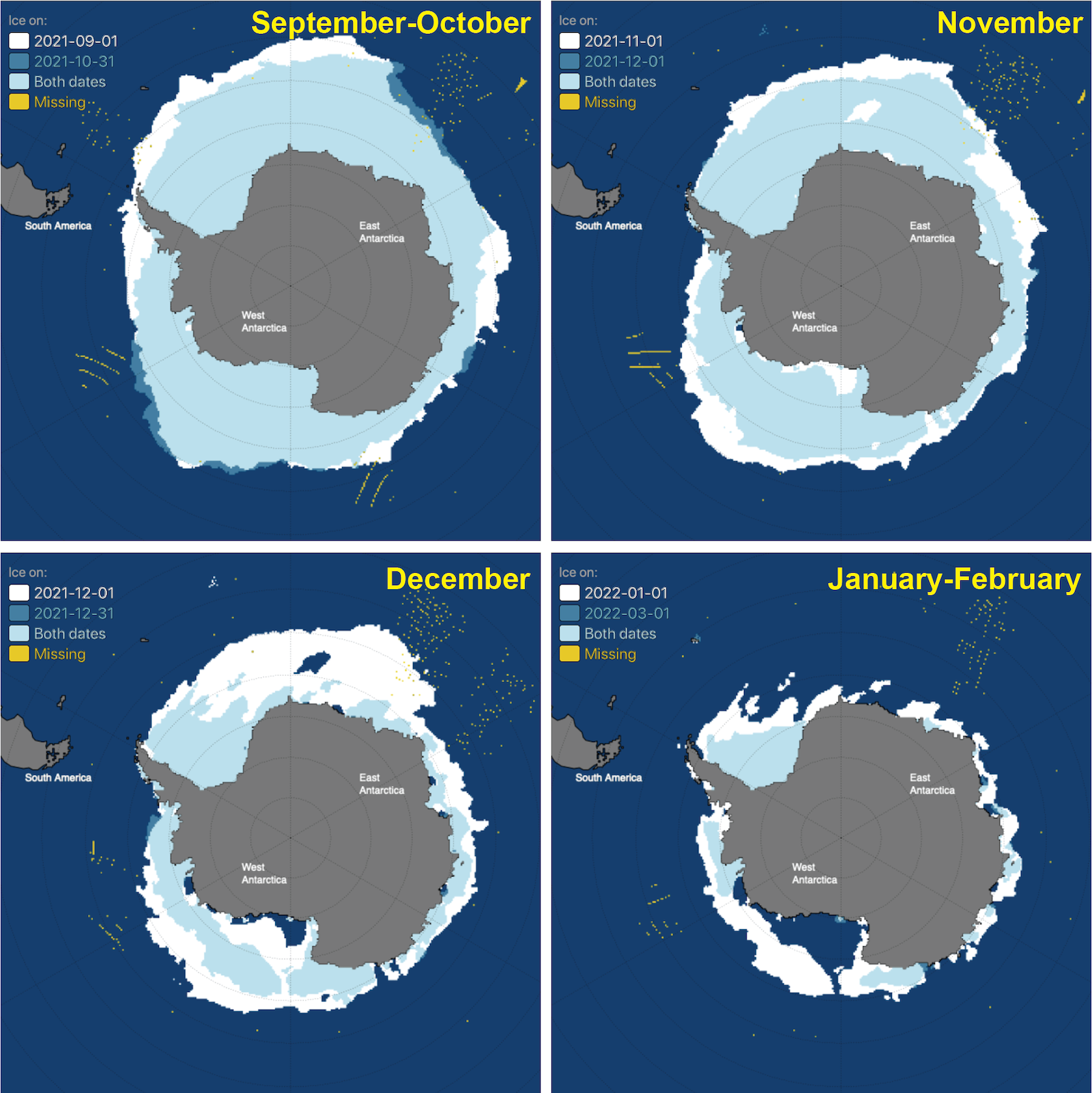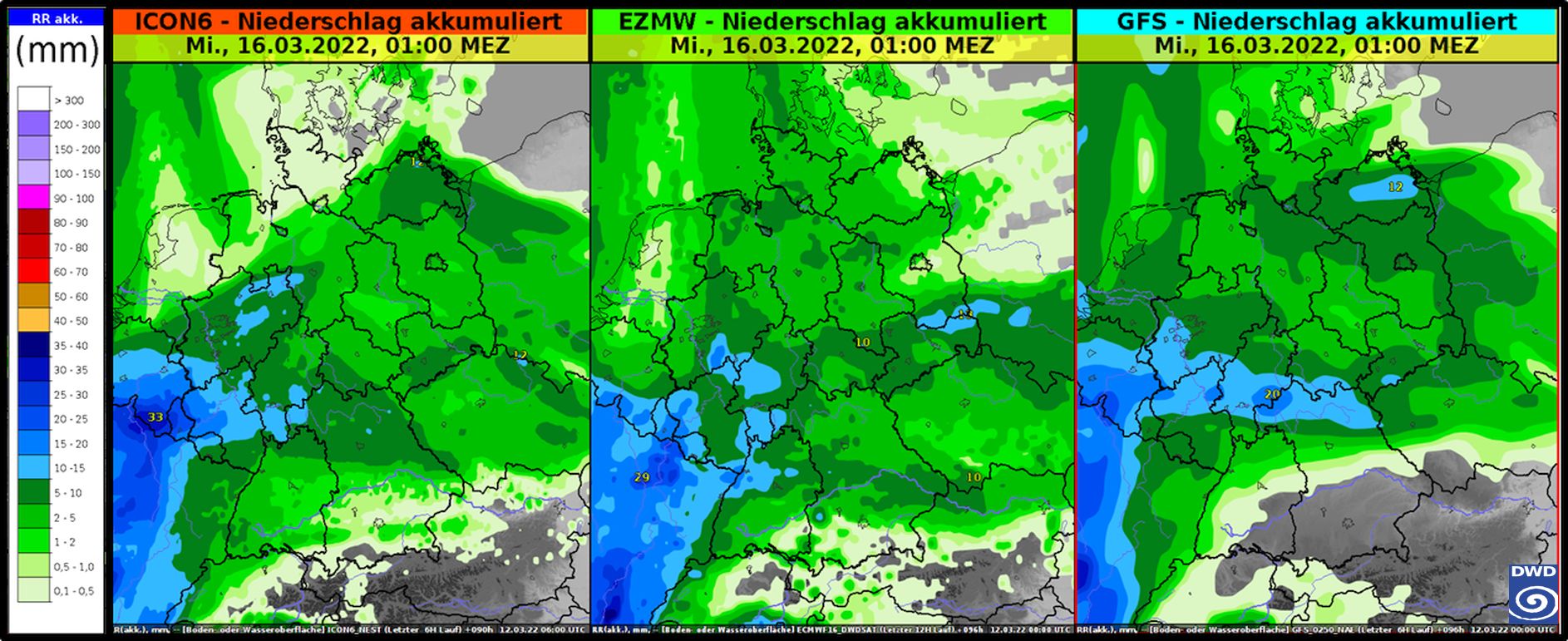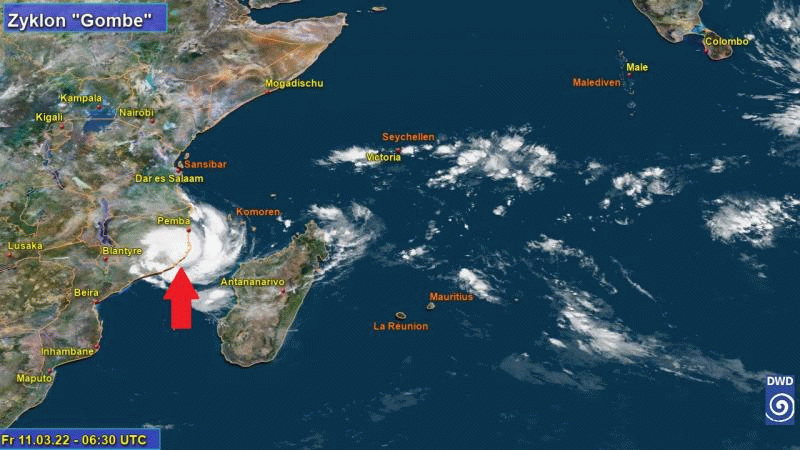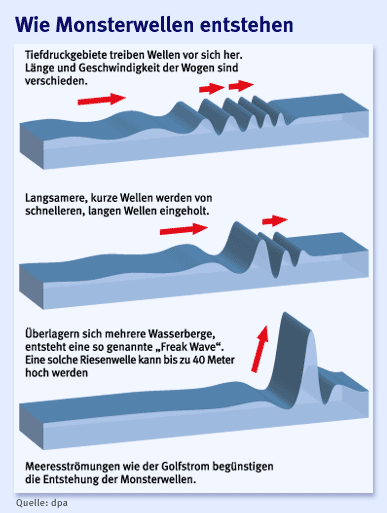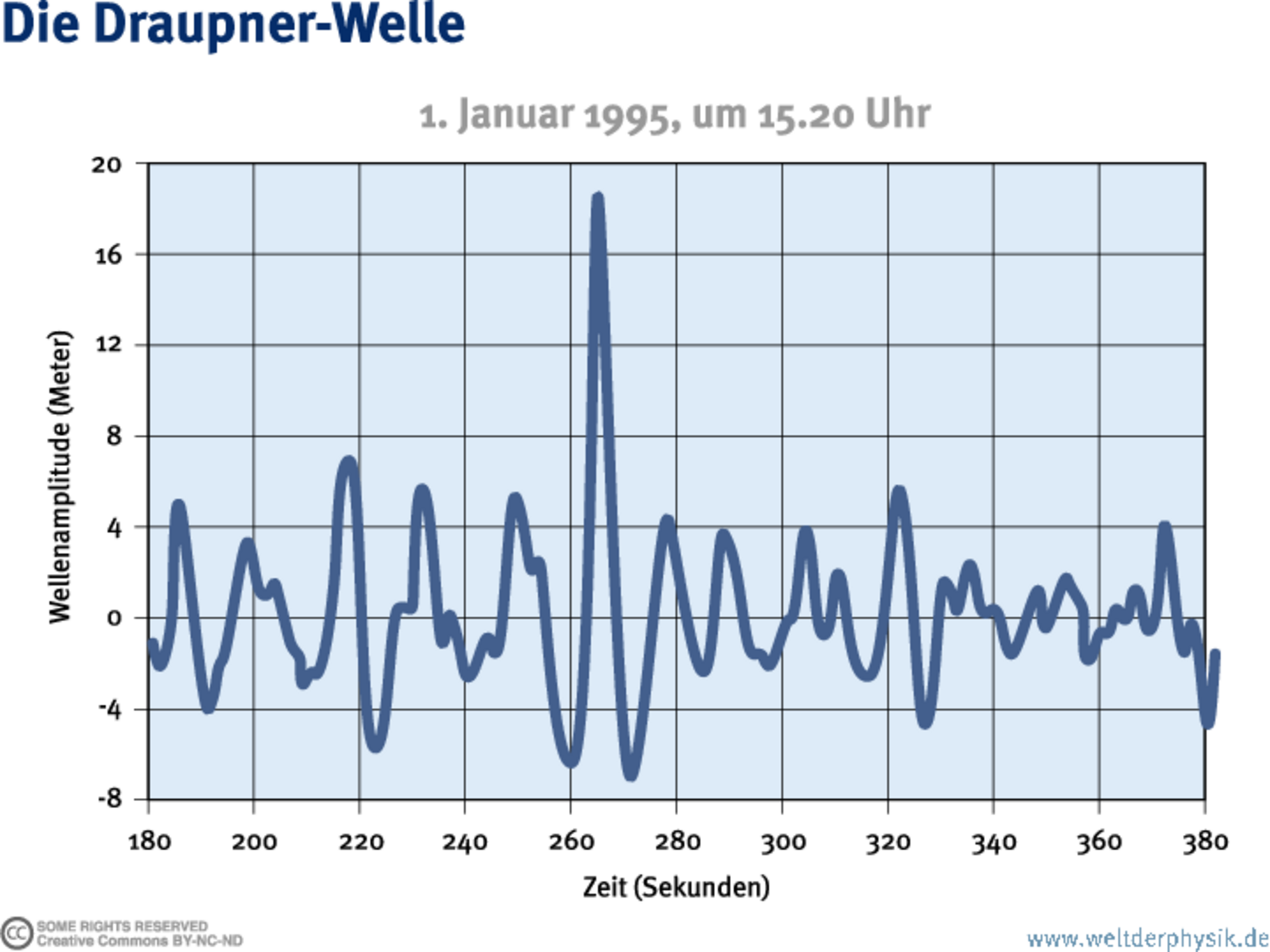Was wäre wenn…? – Die Erde ohne Mond!
Der Mond hat erstaunlich große Einflüsse auf die Erde, obwohl er so viel kleiner als diese ist und sich so weit weg von ihr befindet. Deshalb hätte es einen starken Effekt, wenn er nicht mehr da wäre.
Aufgrund der riesigen Massen von Erde und Mond üben die beiden Himmelskörper starke Anziehungskräfte aufeinander aus und beeinflussen sich gegenseitig. Eine Wirkung des Mondes kann man dabei täglich an den Meeresküsten beobachten: die Entstehung von Ebbe und Flut.
Durch die Anziehungskraft des Mondes wird die Erde verformt und somit an den Orten, die dem Mond zugewandt sind, beziehungsweise den Mond abgewandten Seiten, gestreckt und an den anderen Stellen gestaucht. Dadurch gerät auch das Wasser der Meere und Ozeane in Bewegung und es entstehen zweimal täglich Ebbe und Flut. Die Stärke dieser variiert je nach Konstellation von Sonne, Erde und Mond. Befinden sich alle drei Himmelskörper in einer Linie, so sind die Gezeiten besonders stark, man spricht dann von „Springtiden“. Anders sieht es aus, wenn der Mond im rechten Winkel zur Sonne steht (auf der Erde sichtbar als Halbmond). Dann sind die Gezeiten schwächer („Nipptiden“). Dabei gibt es Orte, an denen der Unterschied zwischen Ebbe und Flut stärker ist, wie zum Beispiel an der Bay of Fundy in Kanada. Hier ist eine Differenz der Meeresspiegelhöhe von bis zu 21 Metern möglich. Anders sieht es beispielsweise an der Ostseeküste aus, wo der Tidenhub „nur“ etwa 30 Zentimeter beträgt. Dafür finden Wissenschaftler:innen unterschiedliche Begründungen. Ausschlaggebend ist hierbei jedoch stets das Volumen des Meeres: je größer der Ozean, desto mehr Wasser wird bewegt und somit ist die Differenz auch höher. Auch der Wind kann zu einer Erhöhung der Flut führen, wenn er vom offenen Meer in Richtung Küste weht. Dies wird dann als Sturmflut bezeichnet.
Die Gravitationskraft des Mondes hat darüber hinaus aber auch noch einen weiteren Effekt: Sie ist dafür verantwortlich, dass die Rotationsachse der Erde bezogen auf ihre Umlaufbahn um die Sonne mehr oder weniger stabil um etwa 23,5 Grad geneigt ist.
Doch was wäre, wenn es den Mond nie gegeben hätte? Ohne die Gravitationskraft des Mondes wäre diese Stabilität nicht gegeben. Im Extremfall könnte sich die Rotationsachse der Erde Berechnungen zufolge sogar um bis zu 90 Grad neigen, verglichen mit der Erdumlaufbahn. Infolgedessen wäre eine Hälfte der Erde für ein halbes Jahr komplett der Sonne zugeneigt und die andere Seite hätte mit halbjähriger Dunkelheit und eisigen Temperaturen zu kämpfen. Es gäbe demnach nur zwei Jahreszeiten, was beträchtliche Folgen für unser Klima und damit auch für Flora und Fauna nach sich ziehen würde.
Ohne den Mond gäbe es außerdem natürlich auch nicht die durch ihn hervorgerufenen Gezeiten. Die Erde würde sich dann deutlich schneller um ihre eigene Achse drehen, da der Mond als eine die Erde ausbremsende Kraft im Kräftegleichgewicht von Sonne, Erde und Mond dient. Eine Drehung um die eigene Achse geschähe dann schon innerhalb von 6 bis 8 Stunden und der derzeitige Tag-Nacht-Rhythmus wäre so nicht existent.
Die deutlich schnellere Drehung der Erde hätte auch direkte Auswirkungen auf das Wettergeschehen: Stürme mit Windgeschwindigkeiten von mehreren 100 km/h wären keine Seltenheit und die atmosphärische Zirkulation, so wie wir sie heute kennen, gäbe es in der Form nicht.
Der Mond ist also in vielerlei Hinsicht essenziell für das Leben auf der Erde. Gut also, dass er unseren Planeten voraussichtlich noch ein paar Milliarden Jahre umkreisen wird, auch wenn die Erde bis dahin leider nicht mehr bewohnbar sein wird…
Praktikant Lorenz Gölz in Zusammenarbeit mit Dipl.-Met. Tobias Reinartz
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 17.03.2022
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst