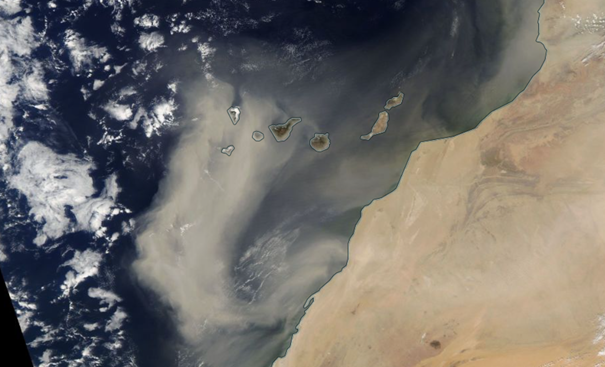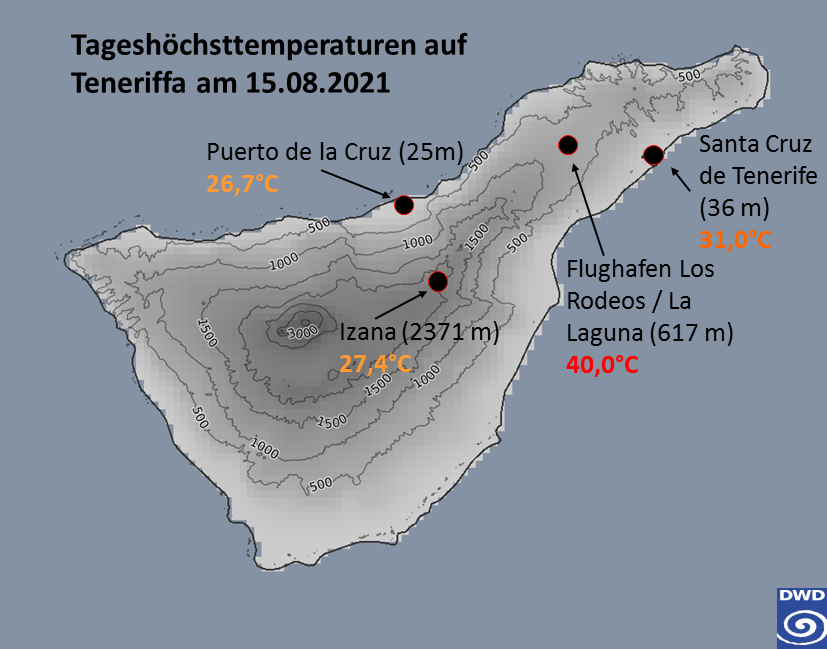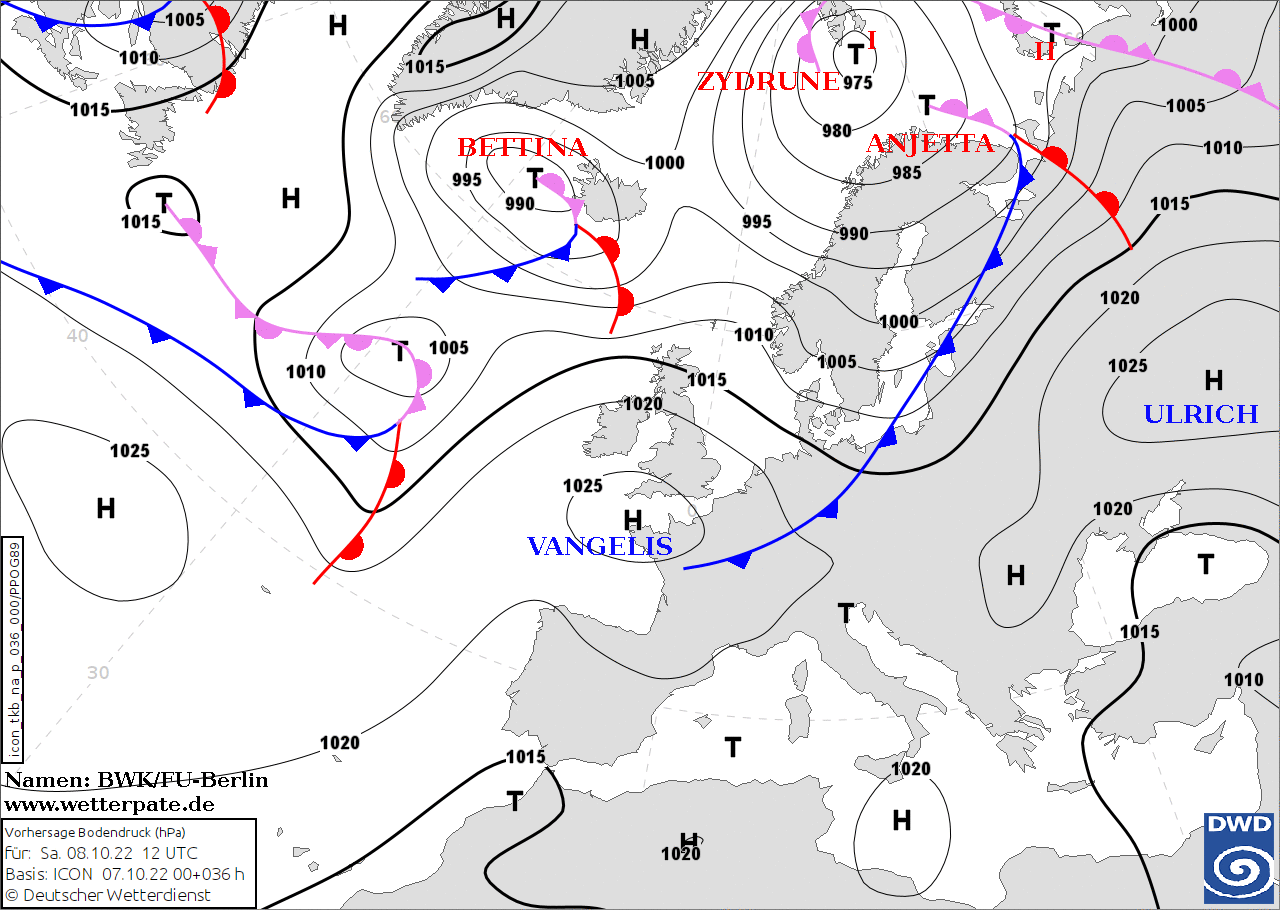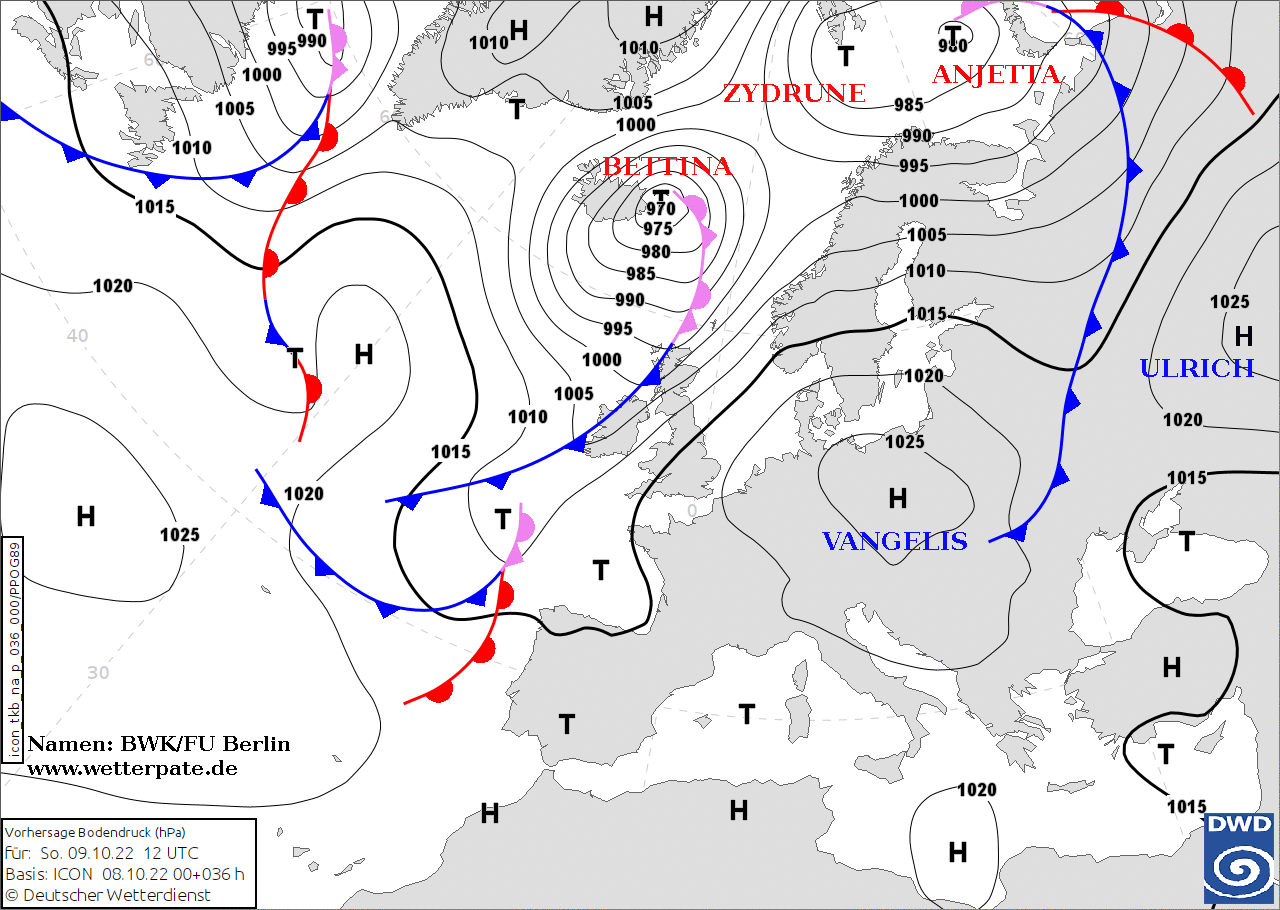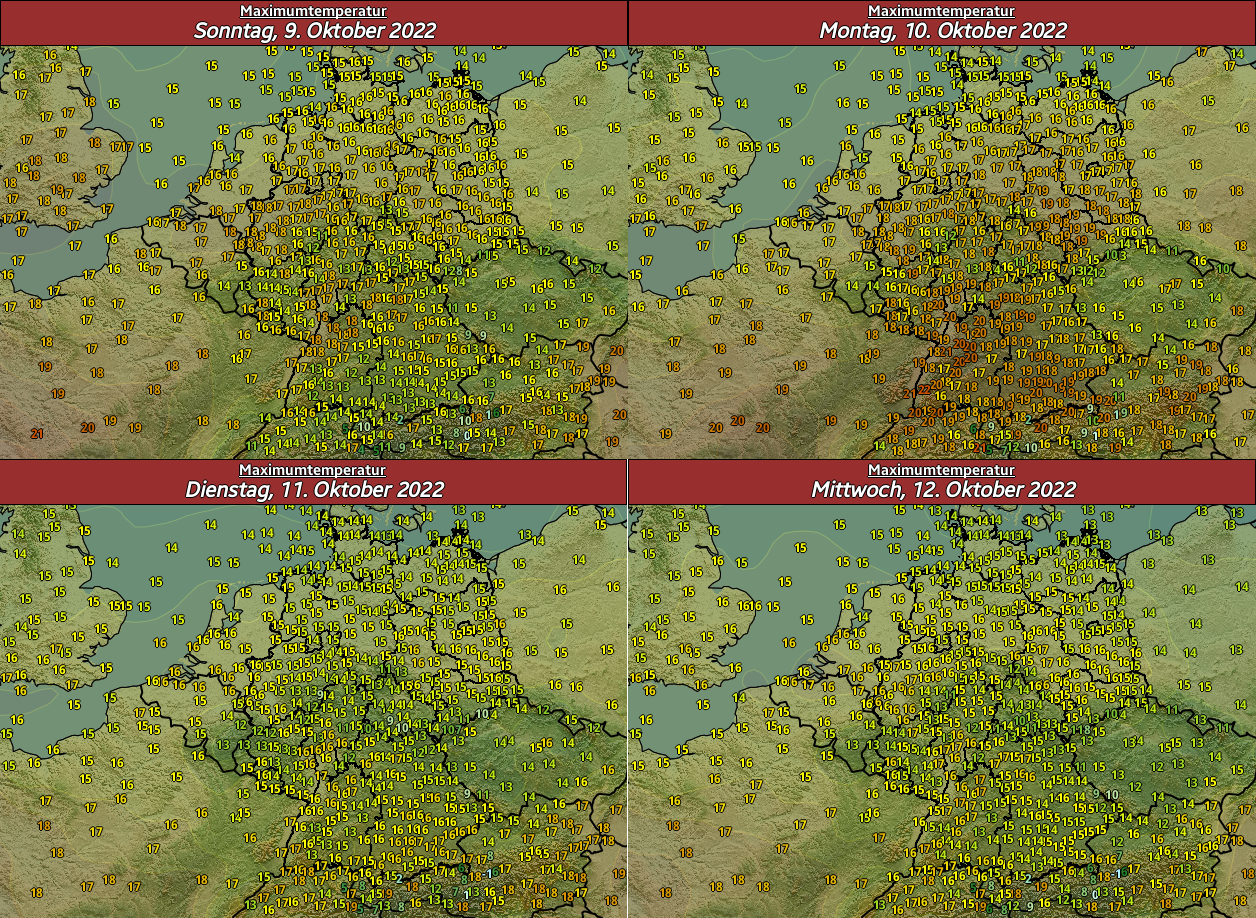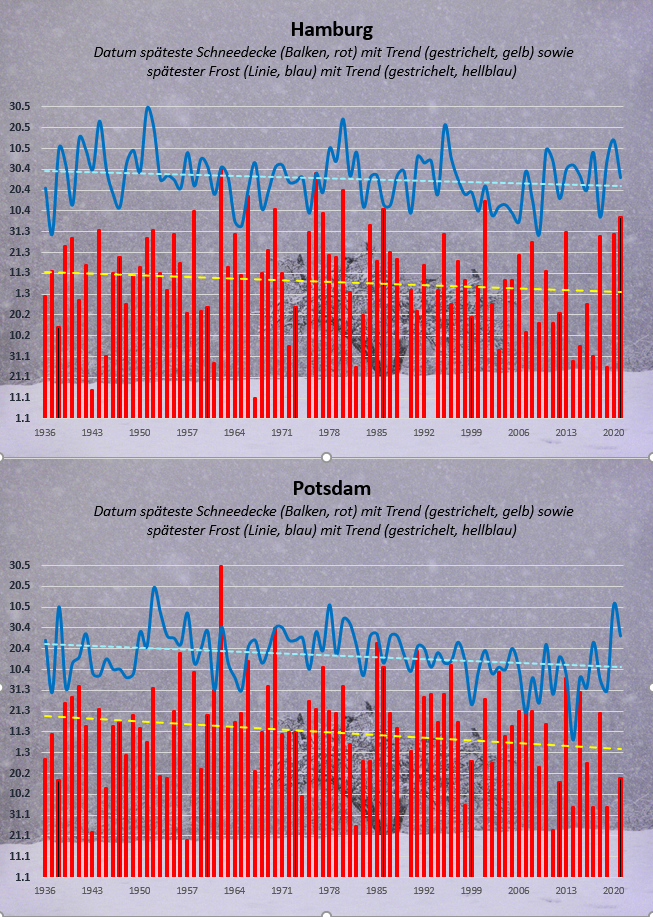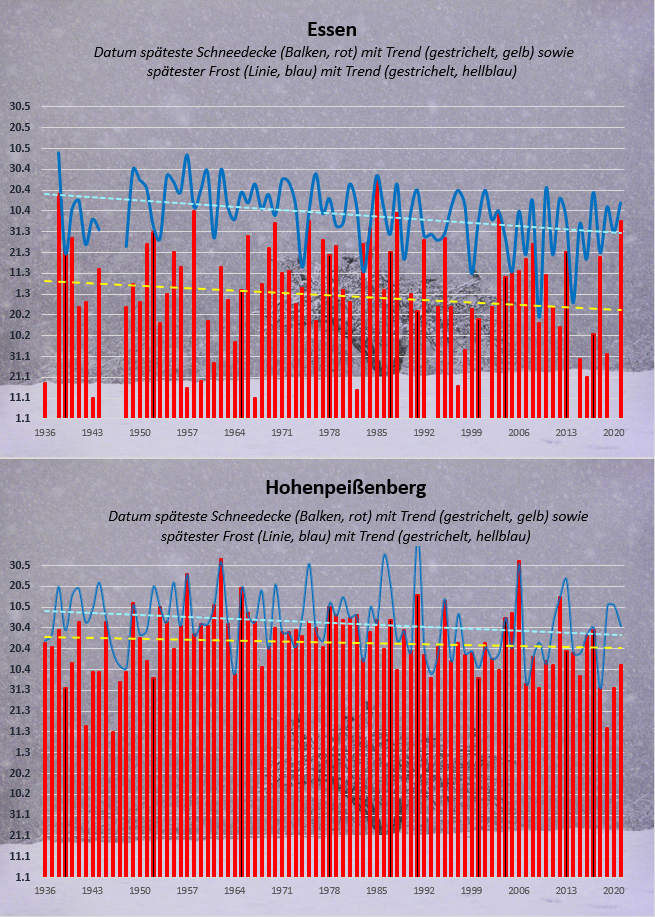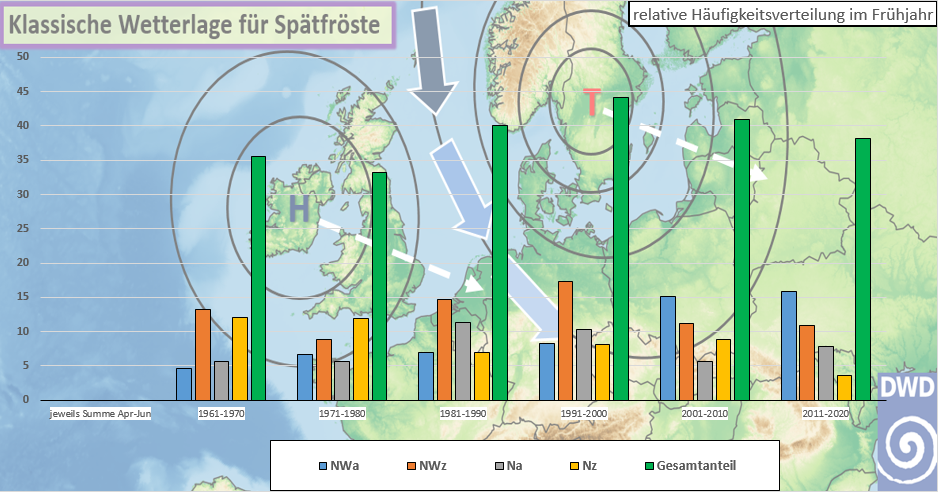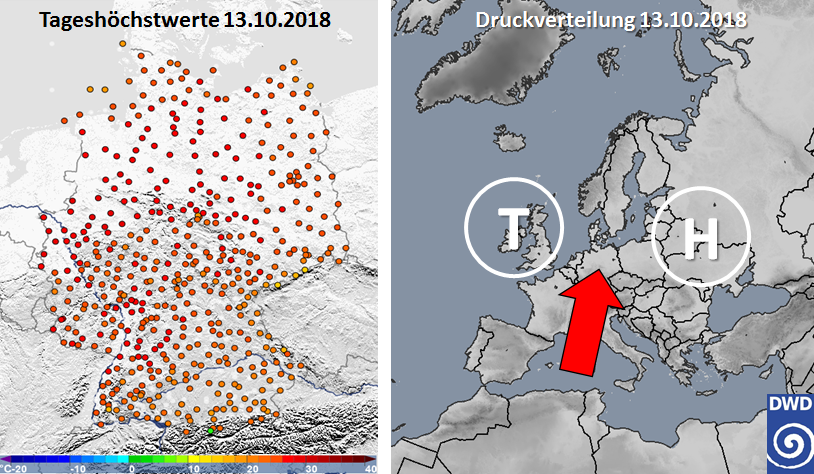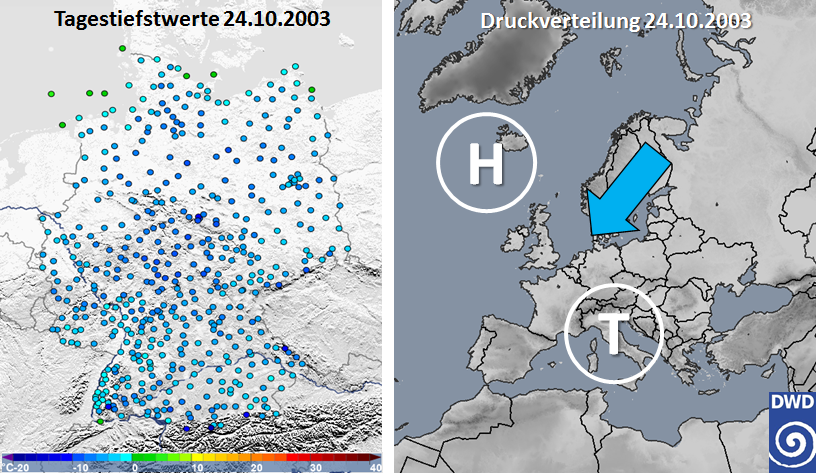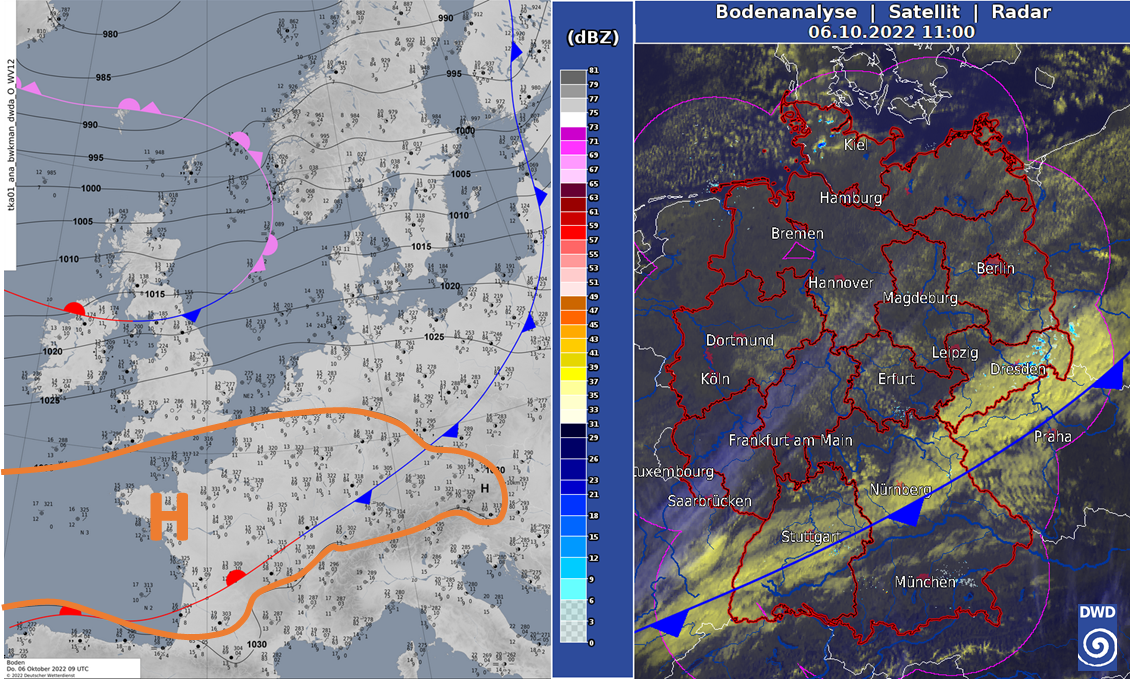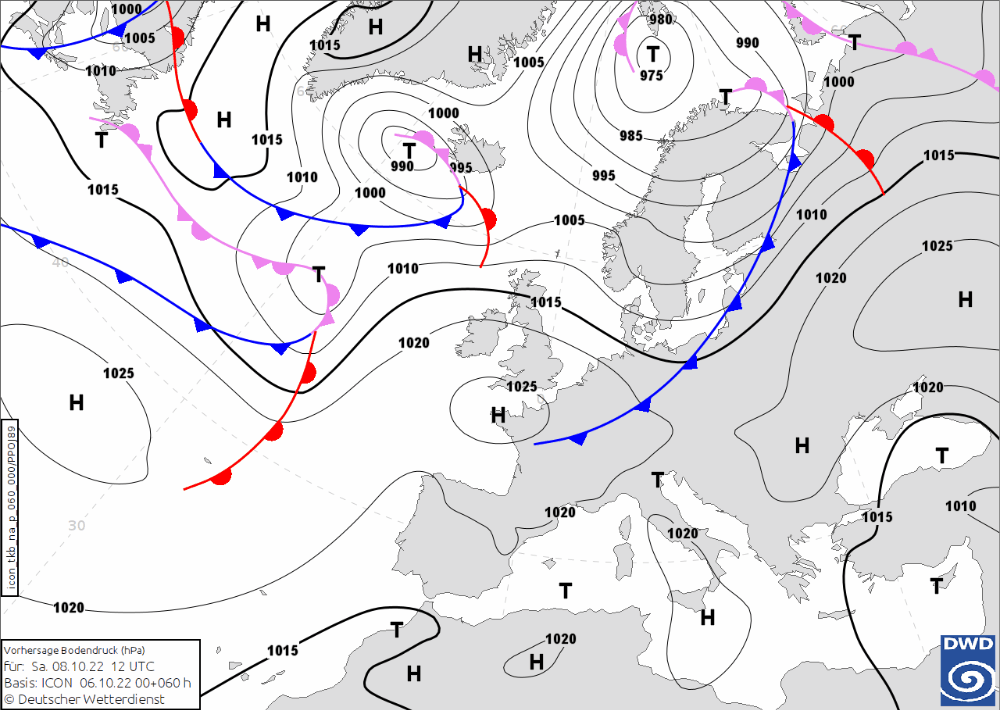Zunächst sei zu erwähnen, dass die Umlaufzeit um die Sonne circa 225 Erdtagen entspricht, ein Venustag hingegen dauert circa 243 Erdtage. Somit ist ein Jahr auf der Venus schneller vorbei als ein Tag. Hinzu kommt, dass sie sich in die andere Richtung dreht als die Erde, die Sonne geht also im Westen auf und im Osten unter.
Neben der Erde besitzt auch die Venus eine Atmosphäre, die Zusammensetzung ist jedoch eine gänzlich andere. Während die Erdatmosphäre ideale Bedingungen zum Leben bietet, gleicht die Atmosphäre der Venus, die hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid (96.5%) und Stickstoff (3.5%) besteht, einem extremen Treibhaus. Dies spielgelt sich auch in der mittleren Temperatur wieder: die mittlere Temperatur auf der Erde liegt bei 15°C, auf der Venus bei 464°C. Ohne den Treibhauseffekt läge die mittlere Temperatur auf der Venus bei -41°C.
Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung besitzt die Atmosphäre der Venus eine etwa 50-mal größere Dichte als die Erdatmosphäre, wodurch sich auch der Bodendruck unterscheidet. Der Bodendruck auf der Venus entspricht dem Druck, der auf einem lastet, wenn man in einer Tiefe von 910 Metern taucht (zum Vergleich, die tiefste Stelle der Ostsee liegt bei etwa 460 Metern unter null). Damit liegt der Atmosphärendruck an der Oberfläche der Venus bei 92 bar (das sind 92000 hPa).
Innerhalb der Venusatmosphäre gibt es eine 20 Kilometer dicke, dauerhaft geschlossene Wolkendecke. Diese Wolkendecke sorgt dafür, dass gerade einmal 2% des Sonnenlichts am Boden ankommen. Der Rest des am Oberrand der Atmosphäre eintreffenden Sonnenlichts wird zu 76% zurückreflektiert und zu 22% absorbiert. Die Erde hingegen reflektiert im Mittel etwa 30% (in den Polargebieten etwas mehr, über den Ozeanen weniger). Gäbe es die Wolkendecke auf der Venus nicht, würde die Atmosphäre aufgrund ihrer Zusammensetzung noch mehr der solaren Einstrahlung absorbieren und es durch den Treibhauseffekt noch wärmer sein.
Wäre es möglich, ohne dabei zu sterben, auf der Oberfläche der Venus zu stehen, könnte man denken, es sei windstill, allerhöchstens eine leichte Brise wäre zu spüren. Wenn man die Windstärke dort auf die Dichte der Erdatmosphäre umrechnet, entspräche der Wind einem mäßigen Wind, also Beaufort 4.
Auch bei den großräumigen Atmosphärischen Prozessen gibt es bei Erde und Venus ein paar Gemeinsamkeiten: Beide Planeten besitzen eine schnelle Atmosphärenrotation, bei der Erde sind es die Starkwindbänder (auch bekannt als Jetstreams), bei der Venus die oberen Atmosphärenschichten. Neben der Venus und der Erde verfügt nur der Jupitermond Titan über eine derart schnelle Atmosphärenrotation. Eine weitere Gemeinsamkeit gibt es bei der großräumigen Zirkulation innerhalb der Atmosphäre, denn genauso wie die Erde gibt es in der Venusatmosphäre eine Hadley-Zelle.
An dieser Stelle lohnt sich ein Ausblick in die großräumige Zirkulation unserer Erdatmosphäre. Durch unterschiedlich starke Einstrahlung im Jahresverlauf und örtliche Unterschiede in der Reflexion kommt es zu einer örtlichen Differenz der Strahlungsbilanz und Energie. An den Polen entsteht eine negative Strahlungsbilanz und am Äquator eine positive. Es liegt in der Natur der Physik, dass Ungleichgewichte ständig ausglichen werden, so auch die Strahlungsbilanzen und Energien. Um das zu erreichen gibt es die globale Zirkulation.
In der Nähe des Äquators steigt feuchtwarme Luft auf, beim Aufstieg kühlt sie sich ab. Weil kalte Luft weniger Feuchte aufnehmen kann als warme, regnet es dort. Am Ort des Aufstiegs entsteht ein Tiefdruckgebiet. Die aufsteigende Luft bewegt sich gen Norden, etwa auf der Höhe der Azoren sinkt die trockene und kühle Luft wieder ab, dabei erwärmt sie sich. Am Boden strömt die Luft wieder gen Äquator. Durch die Erddrehung ist es keine perfekte Nord-Süd-Strömung, sondern leicht nach Westen abgelenkt, die entstandene Luftströmung ist der Nord-Ost-Passat. Damit ist die erste Zirkulationszelle komplett, genannt wird sie Hadley-Zelle.
Wieder zurück zu den Azoren, dort strömt die Luft nicht nur nach Süden, sondern auch nach Norden. Etwa bei Island steigt die Luft dort wieder auf, über Island entsteht ein Tief – das Islandtief. Von dort strömt ein Teil der aufgestiegenen Luft wieder zurück nach Süden und sinkt über den Azoren ab. Diese Zirkulation heißt Ferrel-Zelle, sie beeinflusst maßgeblich das Wetter in den mittleren Breiten.
Der andere Teil der Luft über Island strömt nach Norden zu den Polen und sinkt dort wieder ab, am Pol entsteht ein Hochdruckgebiet. In den unteren Schichten strömt die Luft zurück nach Island. Diese dritte Zirkulation ist die Polarzelle.
Die Erde besitzt dementsprechend drei Zirkulationszellen, die Venus hingegen nur die Hadley-Zelle. Die Hadley-Zelle der Venus ist jedoch um einiges größer, dort steigt die Luft am Äquator auf und sinkt erst am Pol wieder ab. Der Antrieb dieser Zirkulation ist genauso wie auf der Erde die Energiedifferenz.
Die Venus ähnelt also nicht nur in ihrer Größe und Schwerkraft der Erde, sondern auch bei der Zirkulation gibt es Überschneidungen. Zudem liegt sie in der habitablen Zone, also der Zone um die Sonne, in der auf einem Planeten die Bedingungen für Leben gegeben sein könnten. Wäre es auf der Venus um einiges kühler, wäre sie wahrscheinlich der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem, so liegt der Erdähnlichkeitsindex (ESI) jedoch nur bei 0,44 (wobei der ESI zwischen 0 (keine Ähnlichkeit) und 1 (100% ähnlich) liegt). Der ESI berechnet sich aus der Dichte, dem Radius, der Oberflächentemperatur und der kosmischen Geschwindigkeit (Fluchtgeschwindigkeit um den Planeten zu verlassen, die Schwerkraft fließt bei dieser Berechnung ein).
Der Grund dafür, dass nicht über bemannte Venus-Missionen gesprochen wird ist schlichtweg die enorm hohe Oberflächentemperatur und die Zusammensetzung der Atmosphäre – beides würde wohl kein Mensch überleben. Was die bemannte Raumfahrt angeht bleibt der Mars also weiterhin interessanter.
Dipl.-Met. Marcel Schmid und Praktikantin Carolin Probst
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 04.10.2022
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst